Schon seit 2020 kauft die HOCHBAHN ausschließlich Busse mit emissionsfreiem Antrieb. An den Anblick der E-Busse auf Hamburgs Straßen haben wir uns inzwischen also lange gewöhnt. Aber immer mal wieder tauchen Diskussionen über sie auf: Während sich die einen über die E-Busse freuen (schließlich bringen sie uns den Klimazielen der Stadt näher und machen ganz nebenbei noch unsere Straßen leiser, oder?), werden sie von anderen regelmäßig ins Kreuzfeuer genommen. Dieser Beitrag soll sich einmal gerade um die angeführten Kritikpunkte drehen. Dafür habe ich die Kommentare, die uns auf unserer Instagram-, X- und hvv-Facebook-Page immer wieder begegnen, einmal in den Fakten-Check genommen: Was stimmt, was stimmt nicht, und wo liegt die Wahrheit vielleicht irgendwo dazwischen?
E-Busse sind in der Produktion gar nicht so nachhaltig
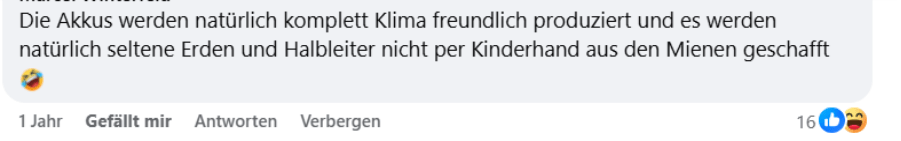
Tatsächlich spricht der User hier ein reales Problem an: Zwar werden die Busse hier in Hamburg mit Öko-Strom und damit nachhaltig betrieben. Wenn man Nachhaltigkeit ganzheitlich denkt, müssen wir uns aber natürlich auch die Vorgeschichte der E-Busse anschauen. Viele Rohstoffe und Vorprodukte für die Batterien stammen nämlich aus Entwicklungs- und Schwellenländern, wo nicht immer klar ist, unter welchen Bedingungen die Menschen dort arbeiten und mit welchen Auswirkungen auf die Natur vor Ort.
Das betrifft grundsätzlich auch die HOCHBAHN. Wie geht das Unternehmen also damit um? Zunächst sind Nachhaltigkeitskriterien bei der Ausschreibung von E-Bussen heute zu 10 % vergaberelevant. Wer also als Unternehmen Busse an die HOCHBAHN verkaufen will, muss erklären, mit welchen Maßnahmen die Probleme in den Lieferketten der Batterien angegangen werden. Und auch das Thema Ökostrom bei der Herstellung der Batterien spielt hier eine Rolle.
Aber wer soll das kontrollieren, so am anderen Ende der Welt, denken sich jetzt wiederum viele. Das habe ich mir einmal von unserer Menschenrechtsbeauftragten erklären lassen: Die HOCHBAHN arbeitet hier mit Electronics Watch zusammen. Die NGO hat ein Netzwerk aus Monitoring-Partnern, die vor Ort (etwa in Bolivien, den Philippinen oder der Demokratischen Republik Kongo) den Austausch zu den Arbeitenden und ihren Vertretungen suchen. Wenn hier auffällt, dass etwa Löhne zu niedrig sind oder nicht gezahlt werden, würde Electronics Watch der HOCHBAHN zunächst regelmäßig von den Untersuchungen berichten. Im nächsten Schritt wird die HOCHBAHN gemeinsam mit den Busherstellern nach Lösungen suchen, die den Betroffenen Abhilfe und Wiedergutmachung verschaffen – und zwar nicht nur mit Blick auf entstandene wirtschaftliche, sondern auch mögliche körperliche oder psychische Schäden. Auch diesen Prozess begleitet dann Electronics Watch.
Am Ende müssen wir hier aber realistisch bleiben: Mit letzter Sicherheit kann die HOCHBAHN nicht sagen, dass die gesamte Lieferkette bis hin zu den Rohstoffen wirklich einwandfrei ist (dasselbe gilt im Übrigen aber auch für Diesel-Fahrzeuge). Einen wahren Kern hat dieser Punkt aktuell also noch. Die HOCHBAHN unternimmt aber bereits Verantwortung, um Nachhaltigkeit auch hier zum Standard machen. Das ist ein wichtiger Schritt.
E-Busse sorgen für tonnenweise Elektroschrott
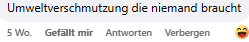
Die E-Busse der HOCHBAHN legen täglich bis zu 270 Kilometer zurück und ja, irgendwann sind die Batterien abgenutzt und müssen gewechselt werden. Bei den E-Bussen der HOCHBAHN ist das je nach Batterie-Typ alle 5 bis 8 Jahre der Fall. Dann gehen die alten Akkus an die Bushersteller zurück, wo sie zumindest zum Teil – je nach Schaden und Batterie-Typ – wieder aufbereitet, teils aber auch entsorgt werden.
Insgesamt ist der Abfall je E-Bus damit also schon recht überschaubar. Trotzdem ist die Devise natürlich: Je weniger Müll am Ende entsteht, desto besser. Auch hier fragt die HOCHBAHN die Hersteller bei der Ausschreibung daher, wie gut die Recyclingfähigkeit der Batterien ist, und berücksichtigt das entsprechend schon bei der Bestellung. Und auch die Zeit arbeitet zum Glück für uns, denn es ist davon auszugehen, dass die Lebensdauer von Batterien in den kommenden Jahren noch weiter verbessern wird. Und auch das bedeutet dann entsprechend: Weniger Müll.
E-Busse fangen schnell an zu brennen
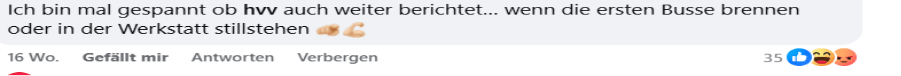
Entwarnung: Laut unseren Fachleuten der FFG (also denen, die die E-Busse der HOCHBAHN seit Stunde 0 ausrüsten, warten und reparieren) ist das Entzündungsrisiko von E-Bussen nicht höher als das eines Dieselbusses. Es dürfte sogar noch etwas niedriger sein, denn anders als bei den klassischen Bussen ist ja keine (bzw. kaum) brennbare Flüssigkeit an Bord.
Sollte es dennoch zu Brand kommen, verläuft dieser aber etwas anders. Für den Fall der Fälle ist die HOCHBAHN daher mit besonderen Vorkehrungen gewappnet: Auf den Betriebshöfen, wo E-Busse übernachten, hat sie Brandmeldeanlagen und Löschwassertanks eingerichtet. Außerdem werden die parkenden E-Busse durch Brandschutzwände in Abschnitte unterteilt, sodass sich ein Feuer nicht über viele Busse hinweg ausbreiten kann. Und auch die Feuerwehr Hamburg ist heute sehr gut auf das Löschen von E-Bussen eingestellt.
Gerade geht die HOCHBAHN sogar noch einen Schritt weiter, denn mit dem vom Fahrzeug übertragenen sogenannten “kritischen Batteriesignal“ soll künftig noch schneller reagiert werden: Schon wenn es Abweichungen vom Sollzustand der Hochvoltbatterie gibt, trennt das Fahrzeug die betroffene Batterie vom Hochvoltsystem und meldet sich über die Ladeschnittstelle automatisch bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Leitstelle und der Feuerwehr.
Die Sache mit der Diesel-Heizung
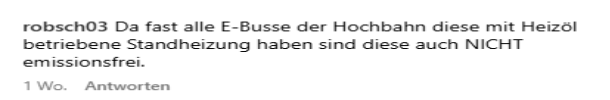
Das stimmt, die E-Busse haben aktuell noch heizölbetriebene Zusatzheizungen an Bord, auch wenn die nur einen Bruchteil der Emissionen beim Fahren ausmachen. Um zu verstehen, warum das so ist, hilft es, einmal auf die Anfangsjahre der E-Busse zurückblicken: Gerade in der ersten Generation hatten E-Busse nämlich noch eine ziemlich knappe Reichweite. Eine alleinige E-Heizung hätte die Batterie hier zusätzlich belastet und die E-Busse damit weitere wertvolle Kilometer gekostet. Daher entstand damals der Kompromiss mit der Dieselheizung. Und auch, wenn die Fortschritte bei den Batterien und damit bei den Reichweiten groß sind, wird uns dieses Problem wohl (bei Hamburgs weitläufigen Strecken) noch eine Weile begleiten. Gleichzeitig rechnen die Expertinnen und Experten mit weiteren Fortschritten in der Batterietechnologie. Das wird dann auch dazu führen, dass wir in absehbarer Zeit auf Dieselheizungen verzichten können.
E-Busse gehen bei heißen Temperaturen in die Knie
Zu guter Letzt bin ich noch dem jüngsten Aufreger auf die Spur gegangen: E-Busse würden bei sommerlichen Temperaturen überhitzen und müssten dann stehenbleiben, um abzukühlen. Auslöser war das TikTok-Video eines Fahrers, der so einen vermeintlichen Vorfall filmte, darunter weit über 1.000 (gelinde gesagt) aufgeregte Kommentare.

Auch dazu habe ich also kurzerhand mit einem Experten der FFG gesprochen: Dass E-Busse hohen Temperaturen nicht standhalten würden, ist ganz klar ein Mythos. Die E-Busse der HOCHBAHN fahren auch im Sommer einwandfrei und zwar ohne, dass sie dabei an Reichweite einbüßen würden. Dass es mal zu einem technischen Problem kommt (in diesem Fall war es keine Überhitzung, sondern ein Software-Fehler), kann natürlich bei jedem Fahrzeug mal passieren – auch, aber eben nicht speziell an warmen Tagen.
Übrigens: Gerade der letzte Post wurde auch von Usern befeuert, die offenbar ein generelles Problem mit Klima-Themen haben und solches Material gerne in ihrem Sinne framen. Hier ist also oft der Wunsch der Vater des Gedankens. Also: Lasst euch nicht ins Bockshorn jagen, bildet euch eure eigene Meinung zu E-Bussen und bleibt dafür bei den Fakten – mit diesen Blog-Beitrag habt ihr dafür jetzt hoffentlich eine gute Grundlage.
Und wenn noch Punkte offengeblieben sind, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Dann forsche ich auch dazu gerne für euch nach 😊
Außerdem interessant:
Warum gibt es Busse, die zu früh abfahren?
Mehr als nur Kameras: Assistenzsysteme für Busfahrerinnen und Busfahrer

Danke für den Bericht. Gibt es schon Auswertungen, ob die Busse nach einigen Jahren für die Hochbahn günstiger sind als konventionelle? Also inkl. Anteil vom Kaufpreis, den die Hochbahn selbst bezahlt, Abschreibung Ladesäule, Strompreis, aber ohne die dann wegfallenden Dieselrechnungen?
Sehr gerne! Zu deiner Frage: So eine Gesamtbilanz gibt es meines Wissens leider nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass sich die E-Busse – wenn sie weiterhin gefördert werden – für die HOCHBAHN und Hamburg rechnen werden. Sollte die Förderung wegfallen, sähe das aber anders aus, weil die E-Busse in der Anschaffung immer noch das 2-3fache eines Dieselbusses kosten.
Es ist eigentlich ganz einfach. Zur Herstellung der Akkus benötigt man Lithium. Wie das gewonnen wird, ob das umweltfreundlich ist, was das für die Menschen, die dort keben, wo Lithium gewonnen wird, kann ich nicht sagen. Ich denke aber, das auch hier das Sprichwort gilt, das jedes Ding 2 Seiten hat.
Ich selbst fahte gerne mit E – Bussen kenne aber auch durch den Ebersealder O – Bus das Fahrverhalten eines Busses mut Elektromotor. Bei Besuchen in Hamburg fällt mir imner wieder auf, das einige Fahrgäste anscheinend immer noch nicht mitvdem rasanten Anfahrverhalten der E – Busse vertraut sind.
Hallo, danke für den Faktencheck. Ich würde gerne einen Punkt ergänzen, der sich wohl nicht weg diskutieren lässt:
Seit einigen Jahren beschaffen Sie vor allem stehplatzoptimierte Fahrzeuge, außerdem produziert Mercedes nur noch Fahrzeuge mit Turmmotoren. Das führt dazu, dass im Standard-Bus statt 30 (Hochbahn) bzw. 35 (VHH) Sitzplätzen nur noch 25 angeboten werden.*
Das mag für Innenstadtstrecken mit häufigem Fahrgastwechsel und kurzer Mitfahrzeit gut passen. Aber für die langen Strecken in die äußeren Bereiche ist das schlicht ein massiver Komfortnachteil und macht Lust aufs Auto.
Es muss doch einen Mittelweg geben, z.B. mehr MAN-Busse (kein Turmmotor, bis zu 30 Plätze bei drei Türen) oder für die Außenbereiche Verzicht auf die dritte Tür (das wären immerhin vier Plätze mehr und trotzdem viel Platz für Kinderwagen und Rollstuhl).
* Die komischen Versuche der Hochbahn mit Ablagen oder Stangen statt Sitzen mal außer Acht gelassen.
Moin und spannender Punkt! Erstmal: Es stimmt, dass die eCitaro-Busse weniger Sitzplätze haben als ihrer Vorgänger (Fakten-Check bestanden 😉). Tatsächlich dienen die entstandenen Freiflächen aber nicht nur als Stehplätze, sondern bieten eben auch Platz für Menschen mit Rollstuhl, Kinderwagen, Rollator usw. Und das sind Fahrgastgruppen, die die HOCHBAHN heute einfach stärker mitdenkt. Der eCitaro ist aus Sicht der HOCHBAHN aber auch sonst das Fahrzeug, das am besten zu den Anforderungen in Hamburg passt. Und ohne dritte Tür dauert es beim Fahrgastwechsel dann wiederum länger, die Busse sammeln schneller mal Verspätung… du siehst denke ich, ganz so einfach ist es leider nicht.
Danke für die Antwort! Die dritte Tür ist für „Fahrgäste mit Rädern“ aber nicht hilfreich, denn dort dürfen sie nicht einsteigen. Ja, in der Innenstadt mit kurzem Haltestellenabstand und häufigem Fahrgastwechsel ergeben mehr Türen Sinn. Aber doch nicht in Außengebieten, in denen z.B. am S-Bahnhof Poppenbüttel der Bus voll wird und die Leute dann über die nächsten 40 Minuten aussteigen (oder eben retoure einzelne einsteigen). Da hassen (und ja, ich meine hassen) es alle, wenn ein Diesel oder E-Bus von Mercedes mit drei Türen kommt, denn das bedeutet klar: es müssen noch mehr Leute stehen als sonst. Und das ist nach körperlicher Arbeit kein Spaß.
Schaut doch zumindest, ob ihr wie die VHH mehr MAN kauft – da gibt es liegende Motoren und immerhin ein paar Plätze mehr, wenn ihr ernsthaft auf allen Linien Dreitürer einsetzen müsst.
Hallo Nora,
Vielen Dank für den Fakten Check. Aber ich bin jetzt etwas verwirrt. In Punkt 3 heißt es, die Busse brennen schlechter weil sie keine brennbaren Flüssigkeiten an Bord haben. Und in Punkt 4 haben sie dann eine Diesel Heizung. Diesel ist doch aber schon eine brennbare Flüssigkeit, oder?
Viele Grüße
Arne
Hallo Arne! Wenn es bei einem Dieselbus zum Brand kommt, dann häufig, weil Treibstoff (meist wegen einer undichten Leitung) auf den heißen Motor tropft. Das ist also ein ganz anderer Mechanismus als bei einem Batterie-Bus. Dazu kommt, dass die Heizung beim E-Bus natürlich viel weniger Diesel fasst als der ganze Tank eines Dieselbusses.
Können wir als Gesellschaft (und auch als Hochbahn) bitte aufhören, immer die gleichen Diskussionen zu führen? Über Themen und Behauptungen, die von rechts kontinuierlich in die Mitte der Gesellschaft gedrückt und keinen einzigem Faktencheck Stand halten? Egal ob Elektromobilität, Migration, Sicherheit (auch im HVV) oder Impfen – auf unsinnige Kommentare zu antworten hat noch nie etwas genutzt. Die Rechten bestimmen worüber wir reden – das muss aufhören.
Es ist sicher richtig, dass solche Fake-Informationen auch gezielt zu bestimmten Zwecken gestreut werden. Ich denke aber, dass es gerade deshalb wichtig ist, sowas aufzudecken und Informationen bereitzustellen, auf die sich Menschen eben verlassen können.
Moin Andreas, vielleicht kann ich dir da was zu sagen.
Punkt 1: wer im Winter bei -10 grad zur Haltestelle kommt ist auch dementsprechend gekleidet (Winterjacke und Mütze)
Punkt 2: auch die Dieselbusse haben eine Zusatzheizung und kommen bei -10 bis -15 grad auch an ihre Grenzen.
Punkt 3: die Masse der Fahrgäste ist in der Regel zwischen 10 und 15 Minuten vielleicht auch mal ne halbe Stunde mit dem Bus unterwegs bevor er umsteigt in U- oder S Bahn.
Punkt 4: sollen die Fahrzeuge auch bei -10 grad eine Innen Temperatur von 16 Grad erreichen und selbst wenn sie nur 10 bis 12 Grad erreichen ist der Unterschied zwischen außen und innen immer noch 20 Grad. Hier kommen wir dann wieder zu Punkt 1“Jacke und Mütze“
Ach fast vergessen die letzten 5 Jahre hatten wir nicht wirklich viel Tage und Nächte die so kalt waren.
Ich hoffe es hilft Ihnen weiter.
Ein Thema wurde hier noch gar nicht behandelt: Geld/Kosten.
Alles zusammengerechnet, also Kosten für Anschaffung, Kosten Energie (Strom statt Diesel) Kosten Ladeinfrastruktur, Wartung der Busse, evtl. Austausch Batterien, Restwerte der Busse nach 5 oder 10 Jahren, haben Sie da nicht insgesamt viel höhere Kosten ? Wer bezahlt die Mehrkosten? Ist der ÖPNV so noch bezahlbar ?
Moin Erwald! Erstmal: Es stimmt, dass E-Busse erstmal teurer sind. Die Mehrkosten, die entstehen, werden aktuell aber noch zu 80% vom Bund übernommen. Und bei der Infrastruktur sind es immerhin 50%. Es ist zu hoffen und zu erwarten, dass die Förderung fortgesetzt wird. So oder so sind E-Busse aber unverzichtbar, wenn wir es mit den Klimazielen ernstnehmen.
Das Klimaziele-Argument hat den Nachteil, dass nicht jeder davon überzeugt ist – ich zum Beispiel; und das nach einiger Zeit am Hamburger Zeit am Hamburger MPI Meteorologie … anderes Thema. Übrigens ist auch das Argument mit den Bundeszuschüssen nicht ganz sauber, aber geschenkt.
E-Busse haben trotzdem Vorzüge. U.a. sollte die Technik theoretisch weniger komplex sein. Was ich mich frage ist: wie sieht es aus wenn man die ganze Kalkulation auf die Laufleistung umlegt?
Hallo ich heiße Amis Muhammad und arbeite als Busfahrer in Italien seit 5 Jahren ich möchte arbeite mit sie wenn möglich bitte kontaktieren Sie mich. Ich habe eu 10 Jahre Visum danke
Hallo und wie schön, dass du die HOCHBAHN unterstützen möchtest! Wir suchen aktuell Busfahrer und Busfahrerinnen, schick also gerne unter diesem Link deine Bewerbung.
Alles Gute für dich!
„ … auch wenn die nur einen Bruchteil der Emissionen ausMACHT.“!
Aufmerksames Auge, ist jetzt angepasst!
Prima Artikel! Gut das die Hochbahn als Vorreiter der Elektrifizierung von Busflotten aus der Praxis berichtet und hilft Mythen abzubauen.
Hallo Martin! Danke für die lieben Worte, das freut mich zu lesen 😊
Der Artikel ist absolute Lüge und Fake. Elektrobusse sind nicht umweltfreundlich, die Batterien werden durch Sklavenarbeit in armen afrikanischen Ländern hergestellt und zerstören dabei vollkommen die Umwelt. Die Batterien gehen schnell kaputt und müssen oft gewechselt werden. Die Menschheit hat längst den Trolleybus erfunden. Österreich, Schweiz, Tschechien und ganz Osteuropa nutzen Trolleybusse. Sie verbinden die Vorteile von normalen Bussen und Elektrobussen, fahren sehr schnell bergauf, beziehen ihre Energie aus den Oberleitungen und ihr Akku ist sehr klein und wird nur für wenige Kilometer autonomen Betrieb benötigt. Da der Akku selten benutzt wird, hält er lange. Die Lebensdauer eines Trolleybusses ist zudem wesentlich länger als die eines Busses. Daher sollte Hamburg endlich aufhören, Geld für irgendwelchen Unsinn auszugeben und endlich Trolleybusse und Straßenbahnen bauen.
Moin Michail! Ich kann gerade gar nicht nachvollziehen, wie du zu diesen Schlüssen kommst. Wenn du Belege oder konkrete Anhaltspunkte für deine Punkte hast, lass uns aber gerne drüber diskutieren.
Der Artikel ist absolute Lüge und Fake. Elektrobusse sind nicht umweltfreundlich, die Batterien werden durch Sklavenarbeit in armen afrikanischen Ländern hergestellt und zerstören dabei vollkommen die Umwelt. Die Batterien gehen schnell kaputt und müssen oft gewechselt werden. Die Menschheit hat längst den Trolleybus erfunden. Österreich, Schweiz, Tschechien und ganz Osteuropa nutzen Trolleybusse. Sie verbinden die Vorteile von normalen Bussen und Elektrobussen, fahren sehr schnell bergauf, beziehen ihre Energie aus den Oberleitungen und ihr Akku ist sehr klein und wird nur für wenige Kilometer autonomen Betrieb benötigt. Da der Akku selten benutzt wird, hält er lange. Die Lebensdauer eines Trolleybusses ist zudem wesentlich länger als die eines Busses. Daher sollte Hamburg endlich aufhören, Geld für irgendwelchen Unsinn auszugeben und endlich Trolleybusse und Straßenbahnen bauen.
Moin liebe Nora,
Ich hatte gestern das erste mal das vergnügen, mit einem E Bus zu fahren. Ist ja alles gut und schön, aber frisst nicht auch die Klimaanlage ordentlich Strom? Was, wenn wir einen strengen Winter bekommen mit Temperaturen unter -10 Grad am Tage? Wie bekommt man dann die Busse warm? Oder müssen die Fahrgäste während der Fahrt frieren? Ich wage mal zu bezweifeln, das die Dieselheizung das schafft. Eine längere Busfahrt in einen kalten Bus ist auch nicht grade berauschend.
Ich bin gespannt auf Ihre Antworten.
Allen Lesern wünsche ich einen schönen Tag.
Gruß
Andreas
Guten Abend,
das war die deutsche Bahn, deren Klimaanlagen bei 33°C in die Knie gingen. Antriebstechnik Landstrom, keine zusätzliche Dieselheizung.
Aber unsere gute alte tolle Technik.
LG
Moin Andreas und danke für den Kommentar! Das stimmt, die Klimaanlagen verbrauchen natürlich ebenfalls Energie. Die E-Busse haben da aber ausreichend Puffer und schaffen die erforderlichen Reichweiten auch bei hohen Temperaturen ohne Probleme.
Und zu deinem Punkt bzgl. der Heizungen: Die HOCHBAHN visiert in den E-Bussen eine Temperatur von mindestens 16 Grad an. Wenn es wirklich knackig kalt ist, heizt dafür nicht nur die Dieselheizung, sondern zusätzlich auch eine Elektroheizung. In der Realität es sich natürlich trotzdem mal anders anfühlen, je nach dem, wie viele Fahrgäste an Bord sind (die ja auch Wärme abgeben), ob es viele oder wenige Fahrgastwechsel (und damit häufiges oder seltenes Türenöffnen) gibt etc. Wenn du tiefer einsteigen möchtest: Ich habe mich damit in diesem Beitrag schonmal ausführlicher befasst.
Dir auch einen schönen Tag!